“Wenn wir auf das schauen, was schon da ist, haben wir ja gar nicht so viel Mangel. Das macht mir Mut. Wir müssten einfach das, was da ist, ein bisschen anders verteilen.”Maja Göpel
„Unsere Gesellschaft zukunftsfähig machen“ - Ein Gespräch mit der Transformationsforscherin Maja Göpel
Esra Kücük, Vorstand der Allianz Foundation, im Gespräch mit Maja Göpel über den Mut zur Transformation, neue notwendige Narrative für eine zukunftsfähige Gesellschaft und Kooperation als neuem Realismus.
26. Juli 2023

Maja Göpel © Anja Weber
Maja Göpel ist Transformationsforscherin, Nachhaltigkeits-Expertin und Gesellschaftswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt transdisziplinäres Denken. Sie ist Honorarprofessorin an der Leuphana Universität in Lüneburg und derzeit eine der wichtigsten Stimmen, wenn es um die Frage geht, wie wir unsere Gesellschaft wieder zukunftsfähig machen. Sie beschäftigt sich in ihren Büchern „Unsere Welt neu denken“ (2020) und „Wir können auch anders“ (2022) mit Themen der Nachhaltigkeit und sozialen Gerechtigkeit und gilt seit deren Erfolg als eine der wichtigsten Vordenkerinnen für eine ökologisch-zentrierte Welt. Maja Göpel ist Allianz Foundation Fellow.
Esra Kücük ist Vorstand der Allianz Foundation. Sie beschäftigt sich mit den Zukunftsfragen einer Gesellschaft im Wandel und setzt sich für Themen wie kulturelle Teilhabe und soziale Gerechtigkeit in Zeiten der Transformation ein.
Esra Kücük: Als Allianz Foundation wollen wir die Lebensgrundlagen der nächsten Generationen verbessern. Da hat es mich nachdenklich gestimmt zu hören, dass Du auf der re:publica im vergangenen Jahr sagtest: „Wir leben jetzt in einer Ära, die nicht mit den letzten 10.000 Jahren vergleichbar ist“. Was meinst Du damit?
Maja Göpel: Die Idee einer neuen Ära kommt von den Geolog*innen. Die Erforschung der Erdschichten sagt viel darüber aus, wie die Erde früher aussah und welche Form von Leben sich quasi eingetragen hat in die Erdkruste. Geolog*innen prägten in diesem Kontext den Begriff des Anthropozäns. Anthropos kommt aus dem Altgriechischen, bedeutet Mensch, der aufrechte Mensch. Ich finde das ganz schön, weil man den Begriff aufrecht hier auch als Haltung auffassen kann. Das Anthropozän, unsere Ära, braucht eine aufrechte Haltung. Anthropozän, weil wir diejenigen sind, die jetzt diese Erdsysteme tatsächlich verändern: Wir machen Natur! Wir sind zur treibenden Kraft der Veränderung der Ökosysteme geworden. Gerade im 20. Jahrhundert sind wir sehr viele geworden und gleichzeitig greifen wir immer intensiver in die Erde ein. Das können wir messen am Pro-Kopf-Konsum, also wie viele Ressourcen pro Kopf oder wie viel Energie pro Kopf wir in Anspruch nehmen.
Esra Kücük: Es mangelt nicht am Wissen über das Problem, das damit einhergeht. Wir wissen, dass ein „Weiter so“ nicht geht. Wie kriegen wir die Transformation von Wissen zu einer Veränderung der Haltung, dem konkreten Handeln zu einem klimaneutralen Alltag hin?
Maja Göpel: Wenn wir uns die Reaktionen auf Berichte wie „Grenzen des Wachstums“ von 1972 anschauen, dann waren sie sehr abwehrend. In der damaligen Modellierung ging es darum, Trends zusammenzudenken: Wie viel Ressourcen nehmen wir aus dem Boden, wie viel Verschmutzung entsteht dadurch? Wie viel Nahrungsmittel können wir dann noch herstellen? Wie wird dadurch auch die Anzahl der Menschen wachsen? Der Bericht wollte zeigen, dass es wichtig ist, frühzeitig anders zu denken, also über erneuerbare Energien nachzudenken oder Landwirtschaft regenerativ auszurichten.
Die vorherrschende Erzählung, die kulturelle Verfasstheit, die Erfolgsgeschichte bis dahin war: wir können immer etwas Neues erfinden, wenn etwas begrenzt ist! Wenn irgendwelche Ressourcen knapp werden, werden die Preise steigen und dann denken wir uns was Neues aus. Optimierung, neue Technologien oder Effizienzsteigerungen waren die Lösungen. Aber Erdsysteme sind lebendige Netzwerke und keine Rohstoff-Baukästen. Wir können sie nicht einfach nach Belieben ab- und aufbauen.
Und wir haben viel zu wenig darüber nachgedacht, wieso wir trotzdem immer mehr brauchen - von allem. Und das sind dann die sogenannten Rebound-Effekte. Die Erfolgsgeschichte war: “Wir befrieden das Miteinander durch mehr. Es wird immer mehr entstehen und dann können auch alle was bekommen.“ In dieser Erzählung gelangt man nie an den Punkt, ernsthaft über die Verteilung eines Kuchens zu sprechen, er kann ja größer werden, wenn einer meckert. Und jetzt sind wir aus meiner Sicht zum ersten Mal an dem Punkt angekommen - global betrachtet und auch in den reichen Ländern -, an dem klar wird, dass die Zutaten für noch mehr Kuchen nicht ohne weiteres gegeben sind. Es ist wichtig, das ehrlich zu beschreiben, um die Frage des Zugriffs möglichst kooperativ anstatt konfrontativ zu beantworten.
Wie wahnsinnig abhängig wir heute zum Beispiel vom global vernetzten Warenstrom sind. Das haben uns die Pandemie und der Krieg gegen die Ukraine nochmal deutlich gezeigt. Und wie stark sich Konflikte um Zugriff auf Ressourcen und Warenströme aufbauen. Wir müssen überlegen: wie können wir die Versorgungssicherheit global viel besser organisieren? Indem wir regenerative Landwirtschaft betreiben und damit das ökologische Vermögen wieder aufbauen. Indem wir möglichst schnell von fossilen Energien ablassen und damit möglichst stabile klimatische Rahmenbedingungen erhalten. Indem wir tatsächlich neue Technologien entwickeln, die aber auch explizit auf diese Lösungswege zielen und nicht auf noch mehr Bequemlichkeit und Konsum für die Personen mit Kaufkraft. Wie können wir mit digitalen Instrumenten beispielsweise eine Kreislaufwirtschaft unterstützen, die den materiellen Bedarf von Volkswirtschaften auf einem sich langfristigen regenerierenden Niveau hält?
Selbst wenn das richtig unangenehm ist: erst durch die ehrliche Problembeschreibung können wir diese Lösungen finden. Wir drücken uns sehr um diesen ersten Schritt herum und erfinden dann lauter Lösungen, die kurzfristig Symptome mildern, aber nicht die Ursachen der Übernutzung ausräumen. Dabei ist es enorm wichtig, die soziale und ökologische Frage zusammenzudenken.
Esra Kücük: Aber können wir als Bürger*innen eigentlich überhaupt etwas ausrichten? Oder ist das nicht die Aufgabe der Industrie und Politik?
Maja Göpel: Ich glaube beides. Es wichtig zu überlegen, wer kann welche Knöpfe drücken. Und natürlich sind wir Bürger*innen auch als Konsument*innen unterwegs. Mit meinem Griff ins Regal oder meiner Nachfrage nach der Herkunft von Produkten oder meiner Geldanlage kann ich ja eine kulturelle Veränderung durchaus anschieben. Und damit verändern sich auch Narrative und Ideen darüber, was „normal“ ist. Die Sozialwissenschaften zeigen deutlich, dass die Vorstellung darüber, was meine Peer-Gruppe für wichtig und richtig hält, mein Verhalten oft mehr beeinflusst als meine isolierte Betrachtung des Themas.
“Es ist die Verantwortung der Regelsetzenden, das Angebot so zu verändern, dass das, was ich aus dem Regal nehmen kann, nachhaltigen Standards entspricht.”Maja Göpel
Esra Kücük: Wird es den Konsument*innen nicht schwer gemacht, dass sie so viel Wissen haben müssen, um genau die richtigen Fragen zu stellen?
Maja Göpel. Genau das ist der nächste Punkt. Es darf überhaupt nicht um eine Individualisierung der Problemlösungen gehen. Ich habe als Teilnehmende unserer Gesellschaft mehrere Rollen, vielleicht bin ich Mutter und habe einen Job oder möchte vielleicht auch mal mit meinem Partner Zeit verbringen oder mit Freund*innen. Das heißt, ich kann nicht den ganzen Tag versuchen nachzulesen, welche Produkte das wenigste Greenwashing beinhalten. Genau deswegen haben wir ja einen sozialen Kontrakt, der sich Gesellschaft nennt und Verfassung und Regelsetzung beinhaltet. Es ist die Verantwortung der Regelsetzenden, das Angebot so zu verändern, dass das, was ich aus dem Regal nehmen kann, nachhaltigen Standards entspricht. Ich als Konsumentin kann dann Nuancen setzen, aber nicht diese Angebotskarte bestimmen.
Dieser Ansatz fällt uns aber bei den ökologischen Aspekten noch schwer. Wenn Babymilch kontaminiert ist, sind sich alle einig, muss sie sofort aus dem Regal geräumt werden. Aber wie langsam wir uns jetzt ranrobben an den Punkt, zu sagen: „Produkte, die unnötig hohe ökologische Schäden mit sich bringen, nehmen wir auch aus dem Programm“. Da kommt dann gerne der Vorwurf der Ökodiktatur und ähnliches. Gleichzeitig sind das aber die Innovationsimpulse, die das Angebot verbessern, eine Qualitätssicherungsspirale nach oben in Gang setzen können. Deshalb ist das Zusammenspiel zwischen der politischen Regelsetzung und den verantwortungsbewussten Produzierenden so wichtig.
Esra Kücük: Wie hoch ist die Bereitschaft innerhalb der Gesellschaft, diesen Wandel mitzugehen? Wie sieht es mit der Gefahr eines social backlashs aus? Wer geht in so einem Transformationsprozess mit und wer wird abgehängt? Wie können wir diese Narration des Zumutbaren gestalten: vom Angst-Narrativ hin zu einem gesellschaftlichen Chancen-Narrativ?
Maja Göpel: Ich glaube, da liegt der ganz große Schlüssel. Wenn wir in die USA schauen, sehen wir ja, was im Zuge von individualisierten Lifestyle Wars passiert. Wo meine primäre Identität sich aus meinem Lebensstil speist und wir aufeinander eindreschen. Die sozialen Medien verstärken das. Da gibt es oft nur Schwarz oder Weiß. Uns gehen die ganzen Nuancen verloren, die wir aber in dem Suchprozess zu den richtigen Lösungen brauchen.
Denn wir haben ja noch gar nicht die nachhaltige Welt als Blaupause vorliegen. Was das angeht, sind wir alle Entwicklungsländer! Kein einziges Land hat bisher ein nachhaltiges Wirtschafts- oder Gesellschaftsmodell. Gefühlt geht es in den Debatten aber nur um die Extreme und Entweder-Oder-Streits. Dabei wird die Realität und wie wir die Zukunft bauen, immer kompromisshaft bleiben. Es wird immer bedeuten, einen Schritt nach dem nächsten zu gehen.
Aber gerade die ersten Schritte zu gehen, damit dann die nächsten leichter werden, ist wichtig. Zum Beispiel, damit ich letztendlich ein anderes System von Mobilität bekomme und ein Auto pro Kopf gar nicht mehr notwendig ist. Dafür muss es jetzt kein Bashing auf diejenigen geben, die aktuell noch davon abhängig sind, weil es die Infrastruktur noch gar nicht anders hergibt. Gleichzeitig gilt es aber zu sagen: Gut, seht zu, dass währenddessen die Investitionen konsequent in das Aufbauen dieser Infrastruktur fließen. Und unnötig riesige und ressourcenschluckende Autos sind in jedem dieser Systeme problemhaft.
Damit sind wir in der Transformations-Forschung oder Innovationsforschung. Das nennt man den ersten, zweiten und dritten Horizont. Der erste Horizont: Ich schaue mir den Status quo an, das aktuelle System und halte das Instand. Immer, wenn es ruckelig wird, investiere ich bei ersten Protesten doch lieber noch mal in das Erhalten, obwohl ich schon weiß, es ist nicht haltbar, es ist nicht zukunftsfähig. Wichtig die Orientierung am dritten Horizont, dass der zukunftsfähigen Versorgungssysteme. Die Vision von nachhaltiger Mobilität, von einem regenerativen Ernährungssystem, gesundheitsorientierte Städteplanung etc.
In dem Moment entsteht ein zweiter Horizont: In diesem spiele sich die Innovationen und Interventionen ab, die es braucht, um von eins nach drei zu kommen, möglichst ohne dass eins erst zusammenkrachen muss.. Jetzt müssen wir noch einmal Gas zukaufen, weil wir noch nicht genug erneuerbare Energien haben. Dabei sollten wir aber nicht eine langfristig orientierte Gasinfrastruktur aus anderen Quellen aufbauen, sondern die Prioritäten weiter darauf belassen, wo wir mittelfristig hinwollen, nämlich in eine erneuerbare Energieversorgung. Damit das Loslassen weniger beschränkend und Angst machend wirkt, weil das Neue, was dann entstehen kann, vorstellbarer und schneller umgesetzt wird.
Esra Kücük: Meine Generation ist groß geworden mit dem Narrativ, dass es jeder Generation seit dem Zweiten Weltkrieg immer besser ging, ein gewisser Aufstieg, das bedeutete Wohlstand. Wenn ich jetzt auf meine Kinder schaue, was sind denn die Narrative, die da Mut machen können?
Maja Göpel: Wenn wir auf das schauen, was schon da ist, haben wir ja gar nicht so viel Mangel. Das macht mir Mut. Wir müssten einfach das, was da ist, ein bisschen anders verteilen und diesen Wettkampf in unserer Gesellschaft domestizieren. Also viel mehr soziokulturelle Veränderungen vorantreiben. Dann muss niemand hungern, dann gibt es genug Wohnraum. Die Frage, die uns antreibt, sollte sein: wie können wir gut leben innerhalb der planetaren Grenzen? Es geht um eine Größenordnung, mit der ich a) gesund und erfüllt leben kann und b) die einem fair Share an Planetennutzung entspricht.
Zusätzlich sollten wir darauf gucken, welche technologischen Sprünge und welche Formen des Wiederaufbaus der Natur, des Regenerierens der Ökosysteme uns wieder mehr Freiheit erlauben. Die Botschaft ist: Die Natur wieder zu stärken, ist ein Geschenk für uns alle. Wenn wir die Ökosysteme wieder aufbauen, wird mehr CO2 gespeichert und es wird schattiger, es wird auch wieder mehr Wasser im Boden geben. Und wenn wir andere Formen von Dünger benutzen, dann können wir weniger abhängig von fossilen Energien sein und durch andere Bodenpflege mit weniger Gülle auskommen, die heute das Grundwasser belastet. In ganz vielen Bereichen geht es gar nicht darum, etwas komplett zu lassen, sondern es besser zu machen! Die Verschwendung rauszunehmen, das Rücksichtslose rauszunehmen. Das Systemische stärken, die Zusammenhänge, wie sie in der Ökologie angelegt sind, so zu verstehen, dass wir sie wieder stärken können.
Im Sozialen sehe ich das auch. Wenn man genau hinhört, was wir uns eigentlich wünschen, dann ist es eher mehr Zeit-Wohlstand, weniger Druck, mit den anderen nicht so stark verglichen zu werden, sicheren Wohnraum, gute Gesundheit. Wenn wir an diesen Stellschrauben drehen, nehmen wir zusätzlich den Druck raus, immer mehr produzieren und konsumieren zu müssen. Das ist eine andere Form, sich über das gute Leben, aber auch über Wohlfahrt und Wohlstand zu verständigen und nach ökonomischen und politischen Innovationen zu suchen, die das stabil organisieren können.
Die Schlagzeile für mich ist in diesem Zusammenhang: „Kooperation ist der neue Realismus“. Themen wie die globalen und ökologischen Gemeingüter, Biodiversität, das Klima, die Erhaltung des Friedens schaffen wir nicht ohne Kooperation. Das heißt aus meiner Sicht, die Seite in uns zu normalisieren, anzufeuern und auch im Diskurs zu stärken, die das Kooperative ausmacht.
Esra Kücük: Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview entstand im Sommer 2022, wurde redaktionell bearbeitet und wird hier stark verkürzt wiedergegeben. Die volle Länge können Sie sich hier anschauen (Youtube).
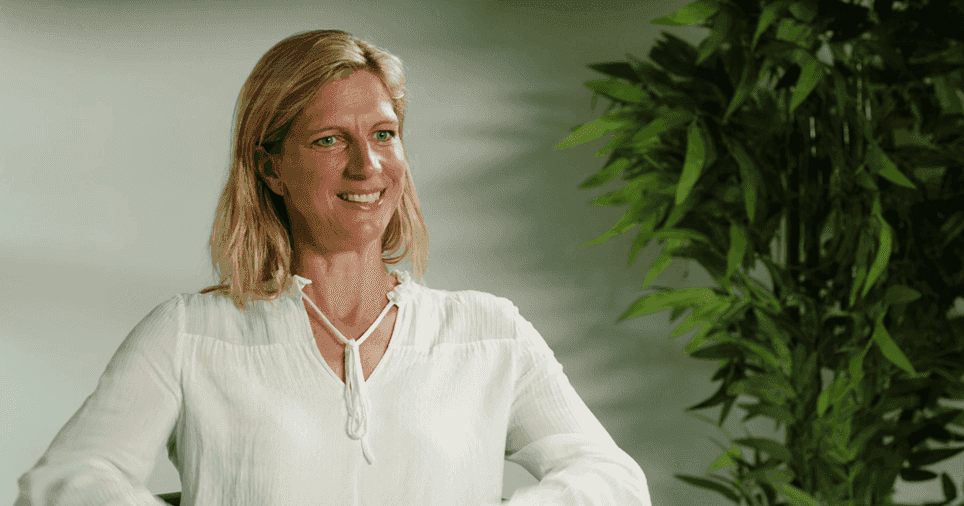
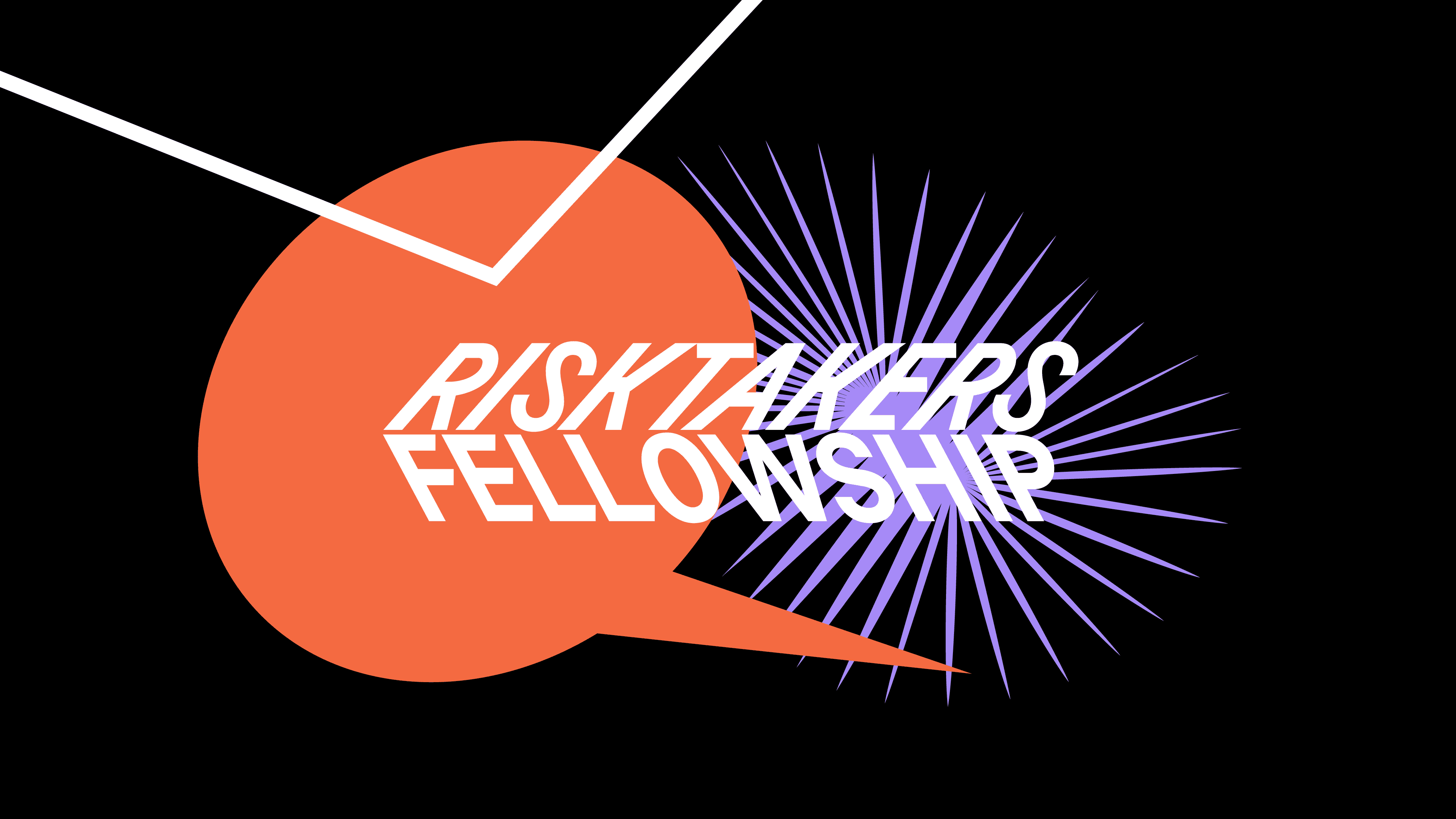
Risktakers Fellowship Call
+ BEWERBUNGSFRIST ABGELAUFEN + Das Risktakers Fellowships will Räume der Hoffnung und Resilienz schaffen. Es unterstützt Menschen, die sich den vielfältigen Krisen unserer Zeit stellen und Ideen für eine wünschenswerte Zukunft entwickeln – auch im digitalen Raum. Das Fellowship ist eine Zusammenarbeit mit SUPERRR LAB.

Climate Cultures Call: Unsere Förderprojekte
Von Schreibworkshops für algerische Student*innen bis hin zum Netzwerk für Klimagerechtigkeit in Europa - Lernen Sie unsere zehn Climate Cultures Förderprojekte kennen!
Der Movers of Tomorrow Award 2025: junges Engagement feiern!
Der Movers of Tomorrow Award, der Engagementpreis der Allianz Foundation, feiert junge Menschen, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen. 50 Movers of Tomorrow haben auch dieses Jahr den Publikumspreis gewonnen und zehn von ihnen den Jury-Preis. Lernt mehr über die wichtige Arbeit der Gewinner*innen!
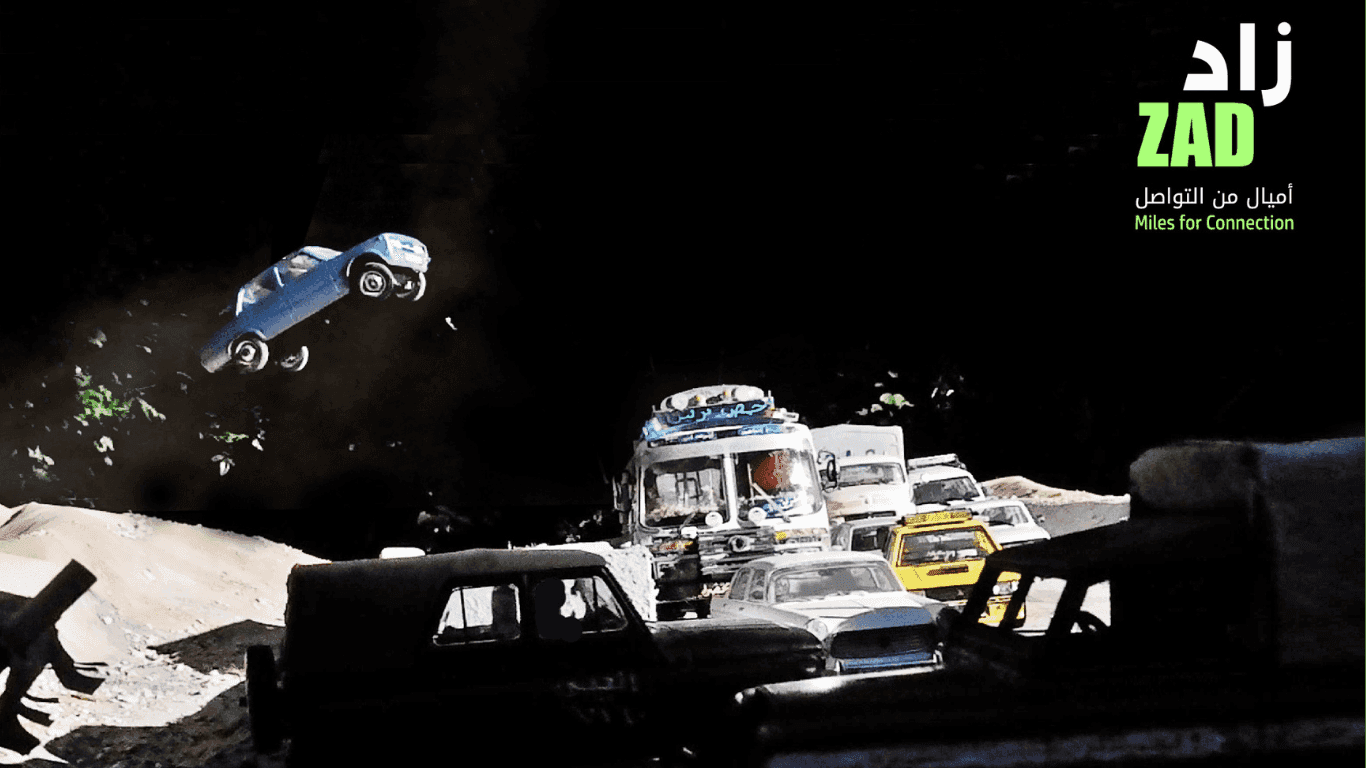
Zad: Miles for Connection
Das Recht auf Freizügigkeit ist für eine Generation von Kunstschaffenden, die nach Europa umsiedeln mussten, von entscheidender Bedeutung. Unser Förderprojekt Zad fördert die Mobilität Kunstschaffender aus dem arabischen Raum, indem es Reisekosten trägt oder finanzielle Unterstützung anbietet, um Werke an neuen Orten präsentieren zu können. Die Bewerbung für das Programm ist ganzjährig möglich.

Allianz Foundation Förderprogramm 2025
+BEWERBUNGSFRIST ABGELAUFEN+ Das Allianz Foundation Förderprogramm 2025 geht an den Start. Wir fördern Initiativen mit zivilgesellschaftlichem, ökologischem, kulturellem & künstlerischem Hintergrund. Einen Schwerpunkt legen wir auf Projekte, die an der Schnittstelle dieser Bereiche arbeiten und einen systemischen Wandel anstreben.
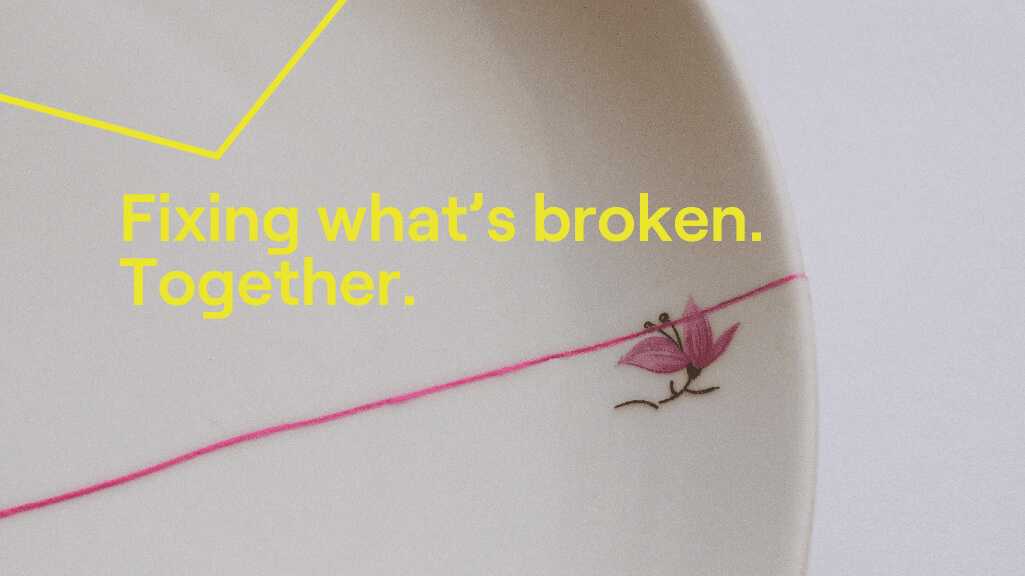
Fixing what’s broken: Unsere Förderprojekte 2024
Zwölf neue Projekte des diesjährigen Förderprogramms – „Fixing what's broken. Together!“ – sind an den Start gegangen. Hier unterstützen wir gezielt Kooperationsprojekte, die gesellschaftlichen Spaltungen und ökologischen Krisen entgegentreten. Ihre Arbeit steht für Solidarität, Gemeinschaftssinn und Respekt. Lernen Sie die Projekte hier kennen.

Media Forward Fund: gemeinwohlorientierten Journalismus nachhaltig fördern
Demokratien brauchen unabhängigen, langfristig und nachhaltig finanzierten Journalismus, denn nur so können vertrauenswürdige und starke Inhalte publiziert werden. Mit diesem Ziel ist der Media Forward Fund im Juli 2024 gestartet. Nun stehen die ersten Förderpartner fest.

Unser neuer Fellow Maja Göpel: Mutiges Wissen und beherztes Wollen verbinden

Unser neuer Fellow Idil Baydar: mit kritischen Fragen und Humor den Integrationsalptraum zerschlagen

Unser neuer Fellow Makan Fofana: Mastermind des Turfurism

Vier Monate in Tarabya

ASSEMBLED: Performance & Wahllokal der Zukunft
Die Allianz Foundation Fellows

ROSA: Feministische humanitäre Hilfe auf Rädern

"On the Vastness of our Identities" – Fotoausstellung zu afro-europäischen Identitäten
